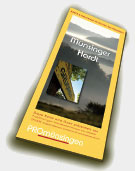Nitrat: Drei „Rote Gebiete“ rund um die Alb
Äcker bei Owen, Sonderbuch und Zwiefalten sind als Nitratgebiete eingestuft. Im „Roten Gebiet“ besteht vor der Düngungung die Pflicht, den Boden auf verfügbaren Stickstoffs untersuchen zu lassen.

Landwirte haben wie jedes Frühjahr wieder die Möglichkeit, die Ausgangssituation im Boden für ihre Stickstoffdüngung mittels einer Nitratprobe im Rahmen des Nitrat-Informations-Dienstes (NID) untersuchen zu lassen.
In Wasserschutz-Problemgebieten in Riederich, Gauingen, Mehrstetten, Bremelau, Dürrenstetten, Apfelstetten, Buttenhausen, Dapfen, Bernloch, Gomadingen, Eglingen, Ödenwaldstetten, Steingebronn, Münzdorf, Indelhausen, Anhausen, Hayingen, Sonderbuch und Zwiefalten, Ackerflächen bewirtschaften, ist dabei die Stickstoff-Düngung nach der Messmethode (Bodenprobe vor Düngung) bei verschiedenen Kulturen und Rahmenbedingungen vorgeschrieben.
Im Nitratgebiet oder „Roten Gebiet“ nach Düngeverordnung DüV (im Kreis Reutlingen betrifft das Teilbereiche von Sonderbuch und Zwiefalten / im Kreis Esslingen unter anderen Owen) besteht vor dem Ausbringen wesentlicher Mengen an Stickstoff ebenfalls die Pflicht zur Untersuchung des im Boden verfügbaren Stickstoffs. Diese Vorgabe gilt für Haupt- und Zweitkulturen, jedoch nicht auf Grünland und Flächen mit mehrschnittigem Feldfutterbau. Für die Ermittlung des Düngebedarfs nach der Düngeverordnung wird die Probenahme nach NID generell empfohlen.
 Die Düngeverordnung (DüV) gilt seit 1. Mai 2020. Bei der Ausweisung der nitratbelasteten Gebiete musste allerdings im Jahr 2022 nachjustiert werden. Die EU-Kommission akzeptierte die in Deutschland angewendete, auf Emissionen begründete Binnendifferenzierung nicht, weil sie nicht mit der EU-Nitratrichtlinie vereinbar war.
Die Düngeverordnung (DüV) gilt seit 1. Mai 2020. Bei der Ausweisung der nitratbelasteten Gebiete musste allerdings im Jahr 2022 nachjustiert werden. Die EU-Kommission akzeptierte die in Deutschland angewendete, auf Emissionen begründete Binnendifferenzierung nicht, weil sie nicht mit der EU-Nitratrichtlinie vereinbar war.
Mit Nitrat belastete Gebiete werden künftig von den Bundesländern nach einheitlichen Standards und im Einklang mit der EU-Nitratrichtlinie ausgewiesen. Die deutsche Landwirtschaft erhält so einen verlässlichen Handlungsrahmen. Dies sieht eine Verwaltungsvorschrift vor, die am 17. August 2022 in Kraft getreten ist.
Die Neufassung der so genannten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Gebietsausweisung ändert das Verfahren zur Ausweisung der belasteten Gebiete durch die Länder – der so genannten „roten Gebiete“ – und vereinheitlicht dieses bundesweit.
Denn in diesen Gebieten gelten strengere Vorschriften für den Gewässerschutz. Grundlage ist die Düngeverordnung, die zum Ziel hat, die Nitratbelastung der Umwelt zu verringern.
Als Grundlage für das neue Ausweisungsverfahren mussten die Länder bis zum 30. November 2022 ihre Düngeverordnungen anpassen und die belasteten Gebiete neu ausweisen. Ausgangspunkt für die Ausweisung der mit Nitrat belasteten Gebiete sind Grundwasserkörper, die einen Schwellenwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter oder eine Nitratkonzentration von mindestens 37,5 Milligramm Nitrat je Liter und einen steigenden Trend aufweisen. Wichtig ist, dass mindestens eine Messstelle im Grundwasserkörper landwirtschaftlich beeinflusst ist.
Die neu ausgewiesenen Nitratgebiete können unter dem Kartenlink der LEL eingesehen werden: https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/68271/index.html
Welche Maßnahmen gelten in der Kulisse?
Anforderungen im mit Nitrat belasteten Gebiet (rotes Gebiet): Bei der Düngung im mit Nitrat belasteten Gebiet müssen die Landwirte auf allen landwirtschaftlich genutzten roten Flächen ihres Betriebs neun zusätzliche Auflagen einhalten. Sieben Maßnahmen sind bundeseinheitlich und mindestens zwei Maßnahmen muss jedes Bundesland selbst festlegen.
Die nachfolgenden sieben Maßnahmen gelten gemäß § 13a DüV bundesweit und sind in den ausgewiesenen nitratbelasteten Gebieten (Roten Gebieten) einzuhalten.
- Verminderung des ermittelten Stickstoffdüngebedarfs um 20 % bezogen auf den Durchschnitt der Betriebsflächen in den ausgewiesenen roten Gebieten: Hierbei ist für jeden Schlag der Stickstoffdüngebedarf der angebauten Kulturen zu ermitteln, zu einer Gesamtsumme zu addieren und um 20 % zu reduzieren. Dieser um 20 % reduzierte N-Düngebedarf ist in der Summe aller im ausgewiesenen Gebiet angebauten Früchte einzuhalten und ermöglicht die bedarfsgerechte N-Düngung einzelner Früchte mit einer hohen betrieblichen Vorzüglichkeit. Die Vorgabe zur Reduktion des N-Düngebedarfs besteht nicht für Betriebe, die im gleichen Düngejahr im Durchschnitt ihrer Flächen im belasteten Gebiet nicht mehr als 160 kg Gesamt-N/ha und davon nicht mehr als 80 kg Gesamt-N/ha in Form von mineralischen Düngemitteln aufbringen. Bei der Berechnung der „160 kg N-Grenze“ sind keine Stall- und Lagerungsverluste sowie Ausbringungsverluste oder Mindestwerte für die Ausnutzung des Stickstoffs zu berücksichtigen, sondern die 160 kg N/ha wird über die Menge an ausgebrachten organischen Düngern und den jeweiligen Gehalten an Gesamt-N berechnet. Der Nachweis, dass die „160 kg N-Grenze“ eingehalten wurde, ist durch die Dokumentation der Düngungsmaßnahmen zu erbringen.
- Einhaltung der schlagbezogenen N-Obergrenze von 170 kg N/ha und Jahr für die Aufbringung von organischen Düngemitteln: Auch bei dieser Grenze sind keine Stall- und Lagerungsverluste sowie Ausbringungsverluste oder Mindestwerte für die Ausnutzung des Stickstoffs in Ansatz zu bringen. Analog zu der unter 1 genannten Vorgabe kann von dieser Regelung abgewichen werden, wenn der Betrieb im Durchschnitt seiner Flächen im nitratbelasteten Gebiet nicht mehr als 160 kg Gesamt-N/ha und davon nicht mehr als 80 kg Gesamt-N/ha in Form von mineralischen Düngemitteln aufbringt. Grundsätzlich sollte vorab eine Vorausplanung durchgeführt werden, inwieweit die 160 kg N-Grenze einzuhalten ist.
- Erweiterung der Sperrfrist um vier Wochen auf Grünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau, d. h. verlängerte Sperrfrist vom 01.10. – 31.01. auf dem Grünland und dem Feldfutterbau.
- Erweiterung der Sperrfrist um sechs Wochen für das Aufbringen von Festmist von Huf- und Klauentieren sowie Kompost auf den Zeitraum vom 1.11. bis 31.01.
- Verbot der Aufbringung von Düngemitteln mit einem wesentlichen N-Gehalt zu Wintergerste, Zwischenfrüchten ohne Futternutzung (Gründüngungszwischenfrüchte) und Winterraps im Herbst: Hinsichtlich der Stickstoffherbstdüngung zu Winterraps besteht eine Ausnahme, wenn der Nmin-Wert im Boden 45 kg N/ha nicht überschreitet. Die Nmin-Probenahmetiefe ist in Niedersachsen auf 0-60 cm festgelegt. Im Herbst ist eine Düngung mit Grünguthäcksel, Pilzsubtrat oder Klärschlammerden als vorgezogene Frühjahrsdüngung zulässig. Die Düngung von Gründüngungszwischenfrüchten mit Festmist von Huf- und Klauentieren oder Kompost wurde hierbei auf 120 kg Gesamt-N/ha begrenzt, die Einhaltung der flächenspezifischen Obergrenze von 170 kg Gesamt-N/ha ist zusätzlich zu beachten.
- Beschränkung der N-Menge über flüssige organische und organisch-mineralische, einschließlich flüssige Wirtschaftsdünger, auf Grünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau auf 60 kg N-Gesamt/ha innerhalb des Zeitraumes vom 01.09. – 30.09.
- Zwischenfruchtanbaugebot, sofern die nachfolgende Sommerung ab dem 01. Februar gedüngt werden soll. Diese Zwischenfrucht darf erst nach dem 15.01. bearbeitet werden. Eine Zerkleinerung des Aufwuchs ohne Bodeneingriff ist schon vorher erlaubt.
Diese Vorgabe gilt nicht, wenn die Ernte nach dem 01. Oktober erfolgt oder bei jährlichen Niederschlägen im langjährigen Mittel unter 550mm. Die Art der Zwischenfrucht (z. B. winterharte oder nicht winterharte Zwischenfrucht) ist nicht vorgegeben. Allerdings muss die Zwischenfrucht aktiv ausgesät werden.
Nitrat im Grundwasser – Das sind die Spitzenreiter 2023
Das Agrar-Informationszentrum Proplanta hat die aktuellsten Erhebungen 2023 vom Umweltbundesamt (UBA) zur Nitratbelastung im Grundwasser ausgewertet und auf einer interaktiven Nitrat-Karte visualisiert. Die Daten stehen jetzt für den Zeitraum 2016-2023 zur Verfügung und verdeutlichen die regionalen Unterschiede und Entwicklungen. Spitzenreiter waren diesmal Wolfsburg, Rheinland-Pfalz-Kreis, Viersen und Bad Dürkheim.
Beim Mehrjahresvergleich fällt sofort auf, dass in 2023 deutlich weniger Nitrat-Messstellen in Deutschland den in der EU-Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG (GWRL) europaweit einheitlich festgelegten Schwellenwert von 50 mg Nitrat je Liter überschritten. Die Novellierung der Düngeverordnung, die zum 1. Mai 2020 in Kraft trat, scheint sukzessive Früchte zu tragen.
Aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs wegen unzureichender Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie war es erforderlich, dass Deutschland seine Düngevorgaben verschärft, um die Nährstoffeffizienz zu verbessern und die Nitratgehalte in den belasteten Teilen des Grundwassers zu reduzieren. Nach intensiven Verhandlungen der Bundesregierung mit der EU-Kommission hatte der Bundesrat am 27. März 2020 der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung zugestimmt.
In diesem Kontext sei erwähnt, dass das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) gestern (28.01.2025) die Ausweisung sogenannter roter Gebiete mit zu hoher Nitratbelastung nach der Landesdüngeverordnung für unwirksam erklärt hat, da die angewandte Methode zur Ermittlung nicht im Einklang mit Vorgaben der bundesrechtlichen Düngeverordnung stünde. Es ist davon auszugehen, dass Gerichte weiterer Bundesländer dieser Auffassung folgen werden. Aufgrund der Revisionsoption könnten jedoch noch Jahre vergehen, bevor eine zumutbare Lösung in Sicht ist, betont das Fachportal proplanta.de.
WEBcode 251074
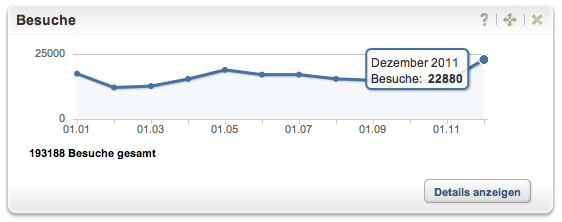
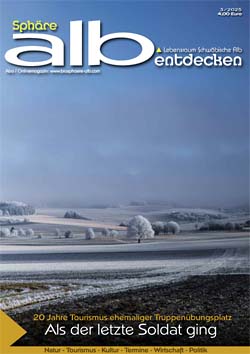
 Großer Skiatlas Schwäbische Alb
Großer Skiatlas Schwäbische Alb
 Interaktive Landkarte
Interaktive Landkarte

 Story-Show
Story-Show Luftschlösser auf Schwäbisch
Luftschlösser auf Schwäbisch